COP30: Zeit für Klimaschutz in Aktion
- Goldstein Carbon

- 6. Nov. 2025
- 4 Min. Lesezeit
Aktualisiert: 7. Nov. 2025

Die COP30 wird als Gipfel erwartet, auf dem Verpflichtungen in konkrete Maßnahmen umgesetzt werden – der Moment, in dem die Ziele des Pariser Abkommens in die reale Umsetzung übergehen. In diesem Artikel konzentrieren wir uns auf die wichtigsten Themen der COP30 und die erwarteten Veränderungen in der Klimapolitik im Lichte der Ergebnisse früherer COPs, insbesondere der COP29.
Inhaltsverzeichnis
Zentrale Themen früherer COP-Gipfel
Die Klimakonferenzen der Vertragsparteien (COP) haben sich in den letzten drei Jahrzehnten zu einem entscheidenden Element der globalen Klimapolitik entwickelt. Das Kyoto-Protokoll (COP3, 1997) führte die ersten völkerrechtlich verbindlichen Verpflichtungen zur Reduzierung von Treibhausgasemissionen ein. Industrieländer mussten ihre Emissionen zwischen 2008 und 2012 im Vergleich zu 1990 um mindestens 5 % senken und nutzten Instrumente wie den internationalen Emissionshandel und den Mechanismus für umweltverträgliche Entwicklung (CDM).
In den zwei Jahrzehnten nach Kyoto konzentrierten sich die Verhandlungen auf die Umsetzung dieser Mechanismen und technische Details. Die COP15 (Kopenhagen, 2009) markierte einen Wendepunkt, da sie versuchte, ein Nachfolgeabkommen für Kyoto zu schaffen. Obwohl sie nur zur unverbindlichen Kopenhagener Übereinkunft führte, brachte sie wichtige Zusagen: Industrieländer sollten bis 2020 umfassende Emissionsziele festlegen, jährlich 100 Milliarden US-Dollar für Entwicklungsländer mobilisieren und den Temperaturanstieg unter 2 °C halten.
Das Pariser Abkommen (COP21, 2015) war ein historischer Meilenstein als erstes universelles, rechtlich bindendes Klimaabkommen, das alle Parteien verpflichtet, national festgelegte Beiträge (NDCs) einzureichen und diese alle fünf Jahre zu verschärfen.
COP29: Überblick über die Klimakonferenz von Baku
Die 29. UN-Klimakonferenz (COP29) fand vom 11. bis 22. November 2024 in Baku, Aserbaidschan, statt. Offiziell als „Finanz-COP“ bezeichnet, versammelte sie Vertreter aus fast 200 Ländern, um einen neuen globalen Klimafinanzierungsrahmen zu schaffen. Rund 66 778 Teilnehmer, darunter Regierungsvertreter, Beobachter und Medien, nahmen teil.
Industrieländer verpflichteten sich, bis 2035 jährlich mindestens 300 Milliarden US-Dollar für den Klimaschutz in Entwicklungsländern zu mobilisieren das Dreifache des bisherigen Ziels von 100 Milliarden US-Dollar, das 2025 ausläuft.
Alle Parteien einigten sich darauf, jährlich mindestens 1,3 Billionen US-Dollar aus öffentlichen und privaten Quellen bereitzustellen. Zur Umsetzung wurde der „Baku–Belém 1.3T-Fahrplan“ verabschiedet, der festlegt, wie die Klimafinanzierung ab 2025 erhöht werden soll.
Kohlenstoffmärkte nach zehn Jahren Verhandlungen aktiviert
Eine der wichtigsten technischen Errungenschaften der COP29 war der Abschluss der lange offenen Artikel-6-Regeln des Pariser Abkommens (2015). Artikel 6 regelt zwei internationale Emissionshandelsmechanismen:
Artikel 6.2 (bilateraler Handel): Länder können international übertragene Minderungsergebnisse (ITMOs) nach eigenen Qualitätsstandards handeln.
Artikel 6.4 (UN-gesteuerter Markt): Ein regulierter globaler Markt unter UN-Aufsicht ermöglicht Ausgabe, Verifizierung und Handel von Kohlenstoffgutschriften mit ökologischen und sozialen Schutzmaßnahmen, einschließlich des Schutzes indigener Rechte.
Die COP29 legte außerdem Methoden für Kohlenstoffentfernung fest und verpflichtete zu starken Umwelt- und Menschenrechtsschutzmaßnahmen. Damit ist das Regelwerk des Pariser Abkommens für Kohlenstoffmärkte vollständig einsatzfähig, und Länder können ab 2025 mit dem Handel beginnen.
Während Fortschritte bei Finanzierung und Kohlenstoffmärkten erzielt wurden, blieb die Emissionsminderung hinter den Erwartungen zurück. Trotz der Verpflichtung, bis 2025 neue NDCs einzureichen, entstand nur begrenzte Dynamik.
UN-Generalsekretär António Guterres fasste das Ergebnis zusammen:
„Dieses Abkommen war entscheidend, um das 1,5 °C-Ziel am Leben zu erhalten – dennoch hatte ich mir ehrgeizigere Ergebnisse in Finanzierung und Minderung erhofft.“
Die COP29 bleibt somit ein Wendepunkt: Sie stärkte die Architektur der Klimafinanzierung, offenbarte aber den Mangel an politischem Willen, fossile Brennstoffe abzuschaffen und ehrgeizigere Ziele zu setzen.
Erwartete Agenda und Schwerpunkte der COP30
Die COP30, die vom 10. bis 21. November 2025 in Belém, Brasilien, stattfinden wird, gilt als „Umsetzungs-COP“ ein Gipfel, der den Übergang von Regelverhandlungen zur praktischen Umsetzung des Klimaschutzes markiert.
Ein Schwerpunkt liegt auf der Vorlage aktualisierter NDCs bis Herbst 2025. Bis September 2025 haben nur 54 von 200 Parteien neue Pläne eingereicht, die meist auf 2035 ausgerichtet sind. Die erste Globale Bestandsaufnahme zeigte, dass die derzeitigen Maßnahmen nicht ausreichen, um die Erwärmung unter 1,5 °C zu halten.
Die Umsetzung der Globalen Bestandsaufnahme steht im Mittelpunkt – mit sechs thematischen Säulen:
Transformation von Energie, Industrie und Verkehr
Schutz von Wäldern, Ozeanen und Biodiversität
Transformation von Landwirtschaft und Ernährungssystemen
Stärkung der Resilienz in Städten, Infrastruktur und Wasser
Förderung der menschlichen und sozialen Entwicklung
Beschleunigung von Klimafinanzierung und gerechtem Übergang
Anpassung ist ein zentrales Thema. COP30-Präsident André Corrêa do Lago betonte, dass fehlende Anpassung den Klimawandel „zu einem Armuts-Multiplikator“ machen würde. Indikatoren und Benchmarks sollen definiert werden, um Fortschritte bei der Klimaanpassung messbar zu machen.
Die Klimafinanzierung bleibt umstritten. Die COP30 wird das neue kollektive quantifizierte Ziel (NCQG) verabschieden, das die unzureichenden 100 Milliarden US-Dollar ersetzt. Es wird über eine Erhöhung auf 1,3 Billionen US-Dollar jährlich verhandelt. Besonders gefährdete Länder fordern direkten Zugang zu Finanzmitteln und spezielle Mechanismen für Verluste und Schäden.
Der Schutz des Amazonas-Regenwaldes und naturbasierte Lösungen erhalten besondere Bedeutung. NGOs fordern jährlich 7 Milliarden US-Dollar zum Schutz des Amazonas, da der Verlust von 50–70 % des Waldes 300 Milliarden Tonnen Kohlenstoff freisetzen würde.
Die Abkehr von fossilen Brennstoffen bleibt ein Streitthema. Die COP30 bietet die Chance, die in COP28 beschlossene Formulierung „Abkehr von fossilen Brennstoffen“ in konkrete Zeitpläne umzusetzen.
Warum die COP30 ein entscheidender Wendepunkt ist
Die COP30 gilt aus mehreren Gründen als kritischer Meilenstein:
1,5 °C-Grenze in Gefahr. Die Erde überschritt 2024 erstmals diesen Schwellenwert. Nationale Zusagen reichen nicht aus, was eine Ambitionslücke offenbart.
Geopolitische Spaltung bedroht die multilaterale Zusammenarbeit. Die US-Rücknahme aus dem Pariser Abkommen, zunehmender Populismus und globale Spannungen schwächen die Klimadiplomatie.
Die Umsetzungsphase des Pariser Abkommens hat begonnen. Der brasilianische Ansatz des „mutirão“ (gemeinschaftliche Mobilisierung) steht für Handeln statt Reden.
Die zentrale Rolle des Amazonas. Die Austragung der COP30 in Belém – im Herzen des Regenwaldes – unterstreicht seine Bedeutung für das Klimagleichgewicht.
Der „Ratchet-Mechanismus“ verlangt höhere Ambitionen. Die Fünfjahreszyklen des Pariser Abkommens erreichen in COP30 einen Höhepunkt.
Von Zusagen zu Verantwortung. COP30 fordert messbare, reale Ergebnisse – ein Zeichen für die Reife der globalen Klimadiplomatie.
Die COP30 findet im Schnittpunkt wissenschaftlicher Dringlichkeit, politischer Fragilität und geografischer Symbolik statt. Ihr Erfolg wird zeigen, ob die multilaterale Klimakooperation trotz geopolitischer Spannungen und eines enger werdenden Zeitfensters transformativen Wandel liefern kann.


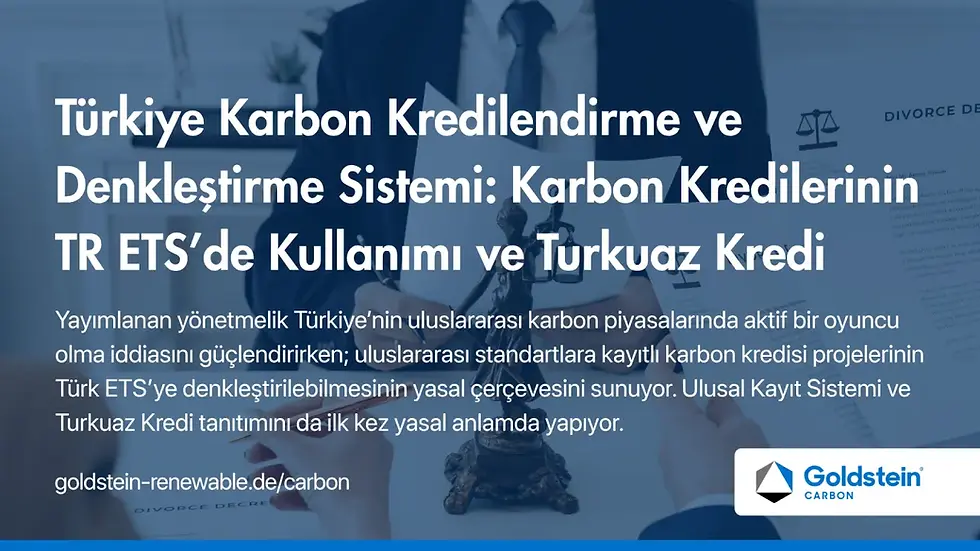
Kommentare